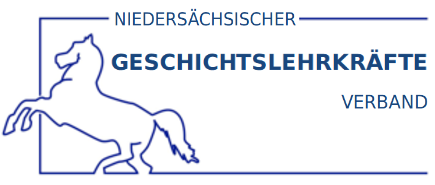Am 21.8.2025 fand die Sommertagung des NGLV im Königsmarcksaal des historischen Rathauses in Stade statt. Rund 65 Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus den Schulen des Elbe-Weser-Dreiecks, aber auch aus ganz Niedersachsen waren dazu erschienen.
Den ersten Vortrag des Vormittags hielt der Hamburger Historiker Professor Dr. Alan Kramer, der bereits auf der letztjährigen Herbsttagung zum Ersten Weltkrieg referiert hatte. Er widmete sich diesmal dem Thema „1914-18 – ein totaler Krieg?“. Der Terminus ist gemeinhin eher aus dem Zweiten Weltkrieg geläufig, doch Kramer zeigte auf, inwieweit bereits der Erste Weltkrieg diesem Konzept entsprach. Der Begriff entstand während des Krieges in der rechtskonservativen Presse. So war im November 1917 in Frankreich von einer „guerre intégrale“ die Rede. Ernst Jünger und Erich Ludendorff führten die deutsche Niederlage auf das Fehlen des totalen Einsatzes der Nation zurück. Nach Stig Förster sind dem totalen Krieg mehrere Dimensionen eigen: Totale Kriegsziele streben eine bedingungslose Kapitulation des Feindes, d. h. seine vollständige Niederwerfung an. Dazu werden alle möglichen Methoden angewandt und das internationale Völker- bzw. Kriegsrecht missachtet. Staat, Gesellschaft und Wirtschaft werden komplett auf den Krieg ausgerichtet, sodass eine totale Mobilisierung sämtlicher Ressourcen stattfindet. Und schließlich werden alle Aspekte des privaten und öffentlichen Lebens auf die Kriegführung ausgerichtet, sodass der Staat eine totale Kontrolle übernimmt. Die Zivilbevölkerung gilt dabei als Rückgrat der Heimatfront.
Frühere Kriege waren zwar mindestens so destruktiv wie der Erste Weltkrieg – man denke an den Dreißigjährigen Krieg, an den Taiping-Aufstand in China mit seinen 20-30 Millionen Toten oder den amerikanischen Bürgerkrieg, in dem ein Viertel der männlichen Bevölkerung der Südstaaten ums Leben kam. Im Ersten Weltkrieg wurden jedoch die gesellschaftlichen Auswirkungen des Krieges durch die Globalisierung potenziert. Auch hier waren bereits Merkmale eines totalen Krieges vorhanden, denn der „Große Krieg“ bündelte alle Elemente in bisher ungekannter Weise und wurde insofern zum Idealtyp des totalen Krieges. Da alle fünf europäischen Großmächte zugleich Imperialmächte waren, gewann er zudem globalen Charakter, wofür der lange andauernde Kampf in Deutsch-Ostafrika mit ca. 500.000 Toten ein Beispiel ist. Der Wohlstand Großbritanniens hing zu 60% vom Welthandel ab; für das Deutsche Reich waren es immerhin 20–30%.
Die Akteure des August 1914 waren sich der Gefahren eines langen, zerstörerischen Krieges durchaus bewusst. So war auch der Schlieffen-Plan rational konstruiert. Moltke wusste um die Blockadegefahr. Die Niederlande waren als „Luftröhre“ Deutschlands vorgesehen und durften neutral bleiben. Moltke fiel daher nach dem Rückzug an der Marne infolge der überlegenen französischen 75mm-Geschütze und des fehlenden Nachschubs in tiefe Verzweiflung. Für die nächsten dreieinhalb Jahre bedeutete das mehr oder weniger Stillstand im Stellungskrieg, der entgegen geläufiger Wahrnehmung verhältnismäßig weniger tödlich war als der Bewegungskrieg zu Beginn.
Kramer nannte dann Elemente des totalen Krieges. Erstmals kamen Massenarmeen zum Einsatz, was insgesamt zu erheblichen Gefallenenzahlen führt. Dabei hatte Serbien mit 5,7% der Gesamtbevölkerung den höchsten Blutzoll aufzuweisen. Das Osmanische Reich kam auf 3,7%, Frankreich auf 3,4% und Deutschland auf 3% der Gesamtbevölkerung. Deutlich geringer war der Anteil in Österreich-Ungarn (1,9%), Russland (1,1%) und Großbritannien (0,1%). Noch eindrucksvoller sind die absoluten Zahlen der Kriegstoten: Deutschland: 2 Millionen, Russland: 1,8 Millionen, Frankreich: 1,4 Millionen, Österreich-Ungarn: 1,1 Millionen, Großbritannien: 761.000. Die Kriegführung war industrialisiert, was zu einer Steigerung der Kampfkraft und der Zerstörungswirkung der eingesetzten Waffen führte. Auch nichtmilitärische Ziele wurden angegriffen. Es kam zur Verwischung der Grenze von Kombattanten und Nichtkombattanten. Das zeigen die Übergriffe auf die belgische Zivilbevölkerung, aber auch der häufige Rekurs auf die „Heimatfront“. Ihren Extremfall erlebten diese Übergriffe im Genozid an der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich. Zunehmend gerierten sich die Imperien als Nationalstaaten. Bereits im August 1914 führte der französische Philosoph Henri Bergson den Gegensatz von Zivilisation und Barbarei in die Diskussion ein, mit dem sich die kriegführenden Mächte im Westen von den Mittelmächten abgrenzten. Ideologisch wurde der Krieg auch im Inneren geführt. Das erklärt unter anderem das Wachstum des Antisemitismus (besonders in Österreich-Ungarn und Russland) im Verlauf des Krieges. Der dazu entwickelte Begriff der „Volksgemeinschaft“ sollte in den Zwanzigerjahren überhöht und rassistisch verengt werden (Deutschland, Italien), um den totalen Krieg der Zukunft vorzubereiten. Jedenfalls finden sich allerorten Mechanismen von Inklusion und Exklusion.
Kramer erläuterte diese Merkmale an konkreten Beispielen: Die alliierte Blockade der Mittelmächte und der deutsche U-Boot-Krieg zielten auf alle Bürger der Feindnationen ab. In Russland, Deutschland und Italien folgte dem staatlichen Absolutheitsanspruch die Delegitimierung des Staates. Der Glaube an ihn war durch Versorgungsprobleme, Rationierung von Konsumgütern, aber auch durch die Wut auf die Privilegierung der Armee, insbesondere die Offiziere, verloren gegangen. Die Bevölkerung hatte sich dem Staat entfremdet, wie sich in der Russischen Revolution, im baldigen Aufstieg des Faschismus in Italien und dem Aufstieg republikfeindlicher Kräfte in der Weimarer Republik zeigte. Das betraf nicht nur die städtische, sondern auch die ländliche Bevölkerung, etwa durch Aktionen wie den „Schweinemord“ in Deutschland 1915 oder die Requirierung von Pferden. An Italien, das sich territorial durchaus ausdehnen konnte, aber politisch und sozial zutiefst destabilisiert war, zeigt sich exemplarisch, dass nach 1918 auch die Sieger ausgelaugt waren.
In einem Brief vom 13.9.1916 an Reichskanzler Bethmann Hollweg schlug Hindenburg drastische Maßnahmen zur Mobilisierung der Zivilbevölkerung für den Krieg vor und griff dabei zu dem leicht abgewandelten Pauluswort: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ (2. Thess. 3, 10). Diese Militarisierung der Arbeit betraf insbesondere die Frauen, aber auch die Kriegsbeschädigten, die wieder in die Arbeitswelt eingegliedert werden sollten. Ferner forderte er die Schließung der Universitäten, um die Studenten in die Wirtschaft zu integrieren. Mittel des Zwangs hielt er für gerechtfertigt.
Die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung veranschaulichte Kramer zum einen an der Besatzungspolitik und der unmittelbaren Kriegserfahrung, zum anderen an den Versorgungsmängeln. Die Besatzungspolitik war auf allen Seiten von Ausbeutung und Repression gekennzeichnet. Die enorme Zerstörung von zehn Départements beschränkte sich indes auf Frankreich. In Deutschland war das kaum bekannt, sodass die anreisende deutsche Delegation schockiert vom Zustand der Landschaft Nordfrankreichs war. „Den Deutschen fehlte ein Verständnis vom realen Krieg“, zitierte Kramer seinen Kollegen Gerd Krumeich zustimmend.
Die Versorgungsmängel führten in Deutschland zu Wachstumsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Für Importe fehlten die Devisen; ferner waren die Getreide- und Futtermittelimporte aus Russland und Kanada zum Erliegen gekommen. Es wurde auch nicht mehr für den Export, sondern für den Krieg produziert. Indes fand Deutschland effektive Antworten auf die Ressourcenknappheit. Die Sterblichkeit der Bevölkerung in Deutschland fiel daher geringer aus als in anderen Staaten, gleichwohl war ein Bewusstsein für das Leiden der Bevölkerung in anderen Ländern kaum vorhanden.
Hunger als Mittel der Politik kam im Osmanischen Reich zum Einsatz. Die Hungerkatastrophen im Rahmen der Verfolgung der Armenier, aber auch in Syrien und im Libanon als Mittel zur Unterdrückung des arabischen Widerstandes sowie als Folge der britischen Blockade sind heute indes genau so vergessen wie die halbe Million Toter der Kriegshandlungen in Deutsch-Ostafrika. Paradoxerweise konnte Großbritannien den Lebensstandard für seine Arbeiterschaft im Krieg sogar steigern.
Mentale Verwerfungen waren eine häufige Erscheinung bei Kriegsteilnehmern. In Großbritannien sprach man vom „Shell shock“, in Deutschland von Kriegszitterern oder Kriegsneurotikern, deren Zahl man auf 200.000 taxierte. Neben brutalen Behandlungsmethoden wie Elektroschocks kam auch die Freudsche Psychoanalyse therapeutisch zum Einsatz.
Der Erste Weltkrieg führte ferner zu Umwälzungen in der politischen Kultur: Der 11.11. ist in Großbritannien und Frankreich ein etablierter Tag der Trauer(gemeinschaft). In Deutschland rissen die Konflikte um Versailles Gräben auf – es gab in der Weimarer Republik ebensowenig eine zentrale Gedenkstätte wie eine innere Waffenruhe. Eine verbindende zentrale Erinnerung an den Krieg entwickelte sich in Deutschland nicht.
Zwar habe der Zweite Weltkrieg den Ersten noch an Totalität übertroffen und die Mittel des totalen Krieges seien noch mehr ausgereizt worden. Dennoch seien sie im Ersten Weltkrieg bereits vollständig angelegt gewesen.
Eine Bibliografie zum Vortrag finden sie HIER.
Im zweiten Beitrag des Vormittags widmete sich Dr. Axel Ehlers, Fachberater in Hannover und stellvertretender Vorsitzender des Verbandes, einem Klassikerthema des Geschichtsunterrichts und einer permanenten Problemzone: der Urteilsbildung.
Seine Bestandsaufnahme ermittelte zunächst verschiedene Definitionen. Dabei ist die Grenze zwischen einem heuristisch-impulsiven und einem – erwünschten – systematisch-reflektierten Urteil noch relativ klar und nachvollziehbar. Schwieriger wird es hingegen bei der Unterscheidung zwischen Sach- und Werturteil, die auf den Urvater Karl-Ernst Jeismann zurückgeht. Bereits Jeismann stellte auch etliche Deutungskategorien zur Verfügung, die indes in der Praxis wenig Verwendung finden. Die Grenzen vom Sach- zum Werturteil sind häufig fließend. Als Kategorien des Werturteils werden oftmals die Verfassungswerte des Grundgesetzes sowie aus dem individuell vertretenen Wertesystem gewonnene Kriterien (Ehrlichkeit, Altruismus, Integrität, Loyalität, Toleranz, Mut, Nachhaltigkeit, Empathie, Versöhnungsbereitschaft) angelegt. Holger Thünemann unterschied jüngst zwischen Valenzurteil vs. Relevanzurteil. Während das Valenzurteil dem herkömmlichen Werturteil nahekommt, indem es eine wertende Stellungnahme abgibt, ermittelt ein Relevanzurteil die Bedeutung eines historischen Sachverhalts für Gegenwart und Zukunft.
Unklarheiten identifizierte Ehlers beim – im Geschichtsunterricht bekanntlich überwiegenden – Sachurteil. Einige Definitionen definieren das Sachurteil als Urteil aus der historischen Zeit heraus: Ein Sachurteil solle gar die Maßstäbe der infrage stehenden Zeit verwenden und den Sachverhalt aus seiner Zeit heraus beurteilen. Andere operierten dagegen mit klaren Kategorien, die das Sachurteil als solches auswiesen, würden es aber durchaus gegenwartsbezogen verstehen, indem sie das historische Phänomen in seiner Beziehung zur Gegenwart verstünden. So würden sich die zahlreichen Definitionen des Sachurteils zwischen den Polen der rein zeitlichen und rein kategorialen Definition ansiedeln.
In den EPA und im KC überwiege nun eine kategoriale Definition des historischen Urteils: Das Sachurteil werde darin nicht an die zeitgenössische Perspektive gebunden. Für das Werturteil seien hingegen die Maßstäbe der Gegenwart – nachvollziehbar – festgeschrieben. Hierin lag eine erste wichtige Erkenntnis seiner Ausführungen.
Urteilsbildung im Geschichtsunterricht erfolge zum einen analytisch. Sie setze sich mit Urteilen anderer auseinander. Reflektiertes Geschichtsbewusstsein bestehe dabei in der Dekonstruktion vorhandener Urteile, der Erfahrung von Kontroversität, der Entwicklung mehrdimensionaler Wahrnehmung und der Einsicht in den Konstruktcharakter historischer Erkenntnis. Zum anderen sei aber auch die eigene, synthetische Formulierung von Urteilen gefordert. Sie führe über Sinngebung und Relevanzreflexion zur Orientierung in der Gegenwart und für die Zukunft, lasse Kontinuität und Wandel erfassen und Pluralität im Diskurs erfahren. Am synthetischen Urteil vollziehe sich der Schritt vom heuristisch-impulsiven zum systematisch-reflektierten Urteil.
Abschließend stellte Ehlers Qualitätskriterien für ein gutes Urteil auf. Es müsse erstens kenntlich sein, indem sowohl die Perspektive klar als auch die Position deutlich werde. Zweitens müsse es konkret sein: Die zugrundeliegende Frage, der Sachverhalt, der Urteilsgegenstand und das Erkenntnisinteresse seien im Vorwege zu klären. Drittens solle es fundiert, also auf einen konkreten Sachverhalt bzw. Material bezogen und viertens müsse es kriterienorientiert erfolgen. Ferner gehörten Strukturierung, Begründung, Aspektreichtum, Differenzierung und Reflektiertheit zu seinen Qualitätsmerkmalen.
Ausdrücklich riet Ehlers von den in Prüfungsarbeiten häufig auftauchenden allgemeinen Kategorien „Legitimität“ und „Effizienz“ als hinreichenden Urteilskriterien ab. Ohne weitere Konkretisierungen seien diese aus der Politikdidaktik übernommenen Oberbegriffe kein Merkmal eines gelungenen historischen Urteils. Das gelte analog für den Begriff „Grundgesetz“.
In der Praxis gelte es somit, Kriterien, Perspektive und Betrachtungsmaßstäbe zu klären sowie Kategorien zu bilden; Wertmaßstäbe müssten bewusst gemacht, Ablehnung bzw. Zustimmung begründet werden. Die Operatoren und ihre Anforderungen seien zu klären und zu üben. Dazu sei ein hohes Maß an Schriftlichkeit angemessen, womit Textprozeduren geübt und reflektiert werden könnten. Darstellungen sollten daraufhin untersucht werden.
Nach einer einstündigen Mittagspause hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen einer Stadtführung, die von der Stader Historikerin und Schwedenzeit-Expertin Dr. Beate-Christine Fiedler durchgeführt wurde, und einem vertiefenden Workshop zur Urteilsbildung. Jan Storre, Lüneburger Fachberater für Geschichte und den englischsprachigen Sachfachunterricht Geschichte, konkretisierte die Ausführungen von Axel Ehlers anhand des Unterrichtsmodells von Max-Simon Kaestner und Britta Wehen (in GWU 1/2 2020, vgl. hierzu die Präsentation von 2022). Es basiert auf der Überlegung, dass insbesondere durch eigenes Schreiben die Urteilsbildung trainiert werden kann. Dazu erlernt der Schüler in einem ersten Zugriff anhand von (ggf. eigens dazu verfassten) Modelltexten hilfreiche strukturierende Prozedurenausdrücke, die er dann im weiteren Unterrichtsverlauf an neuen Beispielen erprobt und anwendet, was wiederum reflektiert wird. Dieses auf einer Dialektik von textuellem Vorbild und eigenem Handeln fußende Unterrichtskonzept stellt ein vielversprechendes Werkzeug dar, wenn es darum geht, Geschichtsunterricht sprachsensibel und kompetenzorientiert durchzuführen. Storre stellte seinen Zuhörern abschließend eine in Anlehnung an das Modell konzipierte Unterrichtseinheit zum Imperialismus vor und erörterte Vorzüge und Desiderate dieses Vorgehens.
Abschließend nahm der Vorsitzende die anstehende Überarbeitung des KC für die Jahrgänge 5-10 zum Anlass, Wünsche und Anregungen der Teilnehmenden entgegenzunehmen und ein Meinungsbild hinsichtlich der Erwartungen zu erstellen.
Johannes Heinßen
Programm:
9.15-9.45 Uhr
Ankunft, Kaffee
9.45-10.00 Uhr
Begrüßung
10.00–11.15 Uhr
Professor Dr. Alan Kramer (Dublin/Hamburg),
1914-1918 – ein totaler Krieg?
(Semesterthema 13.1 Der Erste Weltkrieg)
11.30–12.45 Uhr
Axel Ehlers / Johannes Heinßen / Jan Storre
Urteilsbildung im Geschichtsunterricht. Annäherungen an ein Dauerthema
12.45–14.00 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr–15.30 Uhr
Parallele Workshops
- Urteilsbildung. Workshop zum Vortrag
- Stadtführung Stade
- Novellierung des KC Sek I – Gedankenaustausch